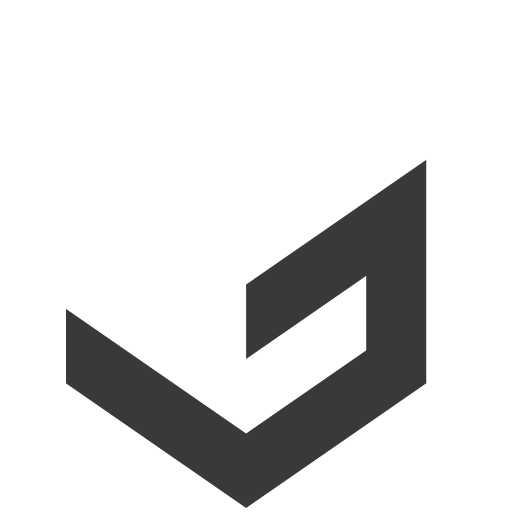„Die Arbeitsbedingungen in Berlin sind prekär“
Johannes Becher (Name geändert) arbeitet seit über zwanzig Jahren in der Veranstaltungsbranche. Er lebt in Berlin und berichtet davon, wie sich seiner Meinung nach die Arbeitsbedingungen der local hands vor Ort in den letzten Jahren verschlechtert haben. Ein Job reicht oft nicht mehr aus.
Wie lange bist Du schon dabei?
Seit mehr als 20 Jahren. Ich habe in ganz Europa gearbeitet, von Irland bis Istanbul, sei es auf Tournee, bei Auftritten oder Festivals mit allem Drum und Dran: PA, Crew und Logistik für Events mit bis zu 80.000 Personen Kapazität.
Woher kommen die Helfer:innen in Berlin?
Wir sind eine bunte Mischung, fast alle sprechen mindestens zwei oder drei Sprachen. Wegen der schwierigen ökonomischen Situation im Land kommen gerade viele Helfer:innen aus Argentinien, aber auch aus Spanien, Portugal, England, den USA oder Australien, Osteuropa, Griechenland, Italien, aus dem Nahen Osten oder vom afrikanischen Kontinent. Was alle gemeinsam haben: Die wenigsten kennen die deutsche Bürokratie und ihre Rechte. Das ist ein Vorteil für die Firmen und ein Nachteil für die Arbeitenden.
Inwiefern?
Die Arbeitsbedingungen sind prekär: Sozial und auch hinsichtlich der Arbeitssicherheit. Viele sind Künstler:innen, die Teil der Berliner Szene sein wollen und nehmen es hin. Aber sie zahlen auch Steuern und Krankenversicherung – und werden trotzdem wie Vollidioten behandelt.
Was verdienen sie?
Am Ende des Monats bleiben dann 1.000 bis 1.150 Euro netto. Der Stundenlohn liegt bei 12,50 bis 17 Euro in der Stunde.
Welche Arbeitsverträge gibt es?
Mit etwas Glück bekommt man eine Teilzeitanstellung mit 80 bis 100 Stunden im Monat und immer mit der längst möglichen Probezeit von 6 Monaten. Manche Teilzeitverträge sind auf Saisonbeschäftigung im Sommer ausgelegt. Auf diese Weise schaffen die Unternehmen Raum, um sich von Mitarbeitern zu trennen, für die sie nach der Saison nicht mehr genug Arbeit haben.
Andere Firmen zahlen einen fixen monatlichen Lohn übers Jahr. Wenn man im Winter nicht arbeitet, weil es wenig Veranstaltungen gibt und der Arbeitgeber keine Aufträge hat, sammeln sich sogenannte „Minusstunden“, die in der Hauptsaison auch mit Überstunden gegengerechnet werden. Dabei muss man unabhängig davon, ob das Einkommen zur Deckung des Lebensbedarfs ausreicht, Arbeitsaufgaben erfüllen. Und gibt es noch einen Null-Stunden-Vertrag, wo Helfer:innen keine Garantie auf Beschäftigung haben und nur für die Stunden bezahlt werden, die sie tatsächlich arbeiten. Das führt dazu, dass man mehrere solcher Verträge hat.
Wenn Du schon so lange dabei bist, kennst Du auch andere Verträge?
Natürlich. Manche haben noch alte Verträge, die alten Punks, von vor 15 Jahren. Aber wenn du jetzt nach Berlin kommst, kriegst du andere Verträge vorgelegt. Und wenn die Preise für ein WG-Zimmer bei 600 Euro liegen, dann brauchst du einen zweiten oder dritten Job. Manchmal ist es notwendig, in der Saison alles auf sich zu nehmen, mit dem Risiko auf eine völlige geistige und körperliche Erschöpfung und auch ohne Rücksicht auf die Arbeitsschutzvorschriften, weil es keine Garantie oder Gewähr dafür gibt, dass im nächsten Monat genug Arbeit da ist. Von den Wintermonaten ganz zu schweigen.
Wie war es, als Du nach Berlin gekommen bist?
Ganz ehrlich? Wenn ich die Situation von damals in England, aber auch in Osteuropa vor zehn bis zwölf Jahren mit der in Berlin heute vergleiche, dann ist das, was ich jetzt hier sehe, verrückt, wie noch im neunzehnten Jahrhundert vielleicht …
Also siehst Du, dass die Bedingungen sich verschlechtert haben?
Nein, andersrum. Sie haben sie nie entwickelt. Das liegt auch daran, dass es in Berlin einen riesigen Markt gibt. Wenn du es nicht machst, macht den Job jemand anderes. Die Branche lebt auch von der Ausbeutung der Helfer:innen. Wenn jemand sagt: ‚Mach‘ ich nicht‘ oder zu viel fragt, wird er gefeuert. Und wenn sich Helfer:innen organisieren, findet man eben anderswo Leute.
Diese Haltung schafft nicht die Voraussetzungen für eine Steigerung der Arbeitseffizienz, d.h. für eine Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen, und zwar für diejenigen, die wissen und verstehen, was und wie sie in bestimmten Positionen arbeiten müssen. Stattdessen wird die Erfahrung und Kunst der Organisation durch Quantität ersetzt. Zum Beispiel durch die Erhöhung der Anzahl von zufälligen, einmaligen Arbeitskräften. Ich denke, das ist eine teurere und weniger sexy Lösung, aber so wird es in Berlin seit jeher gemacht und es gibt keinen Willen, das zu ändern.
Wie ist die Arbeit?
Sie ist körperlich sehr anstrengend und fordernd. Manchmal habe ich 200 Stunden im Monat gearbeitet. Wenn man so lebt, muss man auf Familien- und Sozialleben verzichten. Beides geht nicht. Was geht, um nicht auszubrennen, sind etwa 120 bis 130 Stunden. Außerdem muss man bedenken, dass etwa die Hälfte der Arbeitszeit nachts anfällt.
Du hast auch erwähnt, dass wenig auf Arbeitsschutz geachtet wird. Kannst Du Beispiele nennen, wie sich Berliner Spielorte unterscheiden?
Die Mercedes-Benz Arena ist super. Das ist ein moderner Spielort mit einer großen Kapazität, der für entsprechende Shows geplant wurde. Da haben sich Menschen Gedanken wegen der Abläufe gemacht: Man kann auf viele Arten ab- und aufladen und Wege danach sind kurz.
Es gibt aber auch andere Orte, die multifunktional geplant wurden und in die Jahre gekommen sind wie das Tempodrom, die Max-Schmeling Halle oder die Parkbühne in der Wuhlheide. Ihre technologischen Lösungen sind wahrscheinlich in einigen Aspekten bereits veraltet oder für aktuelle Trends kaum noch ausreichend.
Und manche wurden gebaut, da wusste man noch nichts von Rock‘n’Roll, wie die Waldbühne. Sie sind weniger gut ausgestattet für den Zweck, für den sie genutzt werden. Bei den größeren Open Air-Bühnen ist es daher einfach schwierig, den Arbeitsschutz einzuhalten, weil sie nicht für diese Art von Produktionen ausgerichtet sind.
Wenn die Umstände so sind, wie sie sind, gab es auch schon Unfälle?
Ich weiß von einem Mitarbeiter, der sich schwer am Fuß verletzt hat. Er kam ins Krankenhaus und konnte wochenlang nicht arbeiten. Es war nicht seine Schuld, und die Produktion zog am nächsten Tag weiter. Sie rieten ihm, das mit dem Arbeitgeber auszumachen. Wenn das aber in den USA passiert wäre, wäre er richtig entschädigt worden. Abgesehen davon sind gebrochene Hände oder Finger recht häufig.
Was passiert noch?
Unsichere Arbeitsbedingungen fangen schon viel früher an. Es kommt vor, dass Helfer:innen Papiere zum Unterzeichnen vorgelegt werden und wenn man fragt, was man da unterschreibt, heißt es: Googelt es. Wer auffällt, verliert eher den Job, als dass sich was ändert. Auf Arbeits- und Gesundheitsschutz wird wenig geachtet. Ein Wunder, dass nicht mehr passiert.
Eine gewerkschaftliche Organisation gibt es nicht?
Ein paar von uns sind bei der Freien Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union (FAU). Vor einiger Zeit, als die Fahrer:innen von Gorilla gestreikt haben, wurden sie von ihnen vertreten. Andere sind bei Verdi, die natürlich einen größeren Namen haben.
Ich habe den Eindruck, dass Schein und Sein in der Branche weit auseinander geht.
Einerseits wird Berlin und seine Live Musik-Industrie als so cool verkauft, aber hinter den Kulissen sieht es anders aus. Unter den Bedingungen muss man eine Menge arbeiten, um auf das Geld zu kommen. Die Vorstellung, dass man Kontakte knüpft und sich durch gute Arbeit allmählich nach oben arbeitet, trifft nicht zu. Und genauso ist es bei der Security und beim Catering …
Was könnte man tun?
Lieber weniger Helfer:innen zu besseren Konditionen anstellen, aber dafür solche, die gut ausgebildet für ihre Arbeit sind. Die Firmen wünschen sich das ja eigentlich auch: Helfer:innen, die sich mit dem teuren Equipment auskennen. Letztlich würde so Zeit und damit Geld gespart werden. Arbeitskräfte könnten effizienter eingesetzt werden und ihre Arbeit besser entlohnt.
Interview: Michaela Maria Müller
Und jetzt seid Ihr gefragt: Ist die Geschichte von Johannes Becher ein Einzelfall? Oder ist das die Methode Berlin? Schreibt uns an info@mothergrid.de über Eure Erfahrungen mit der Hauptstadt.